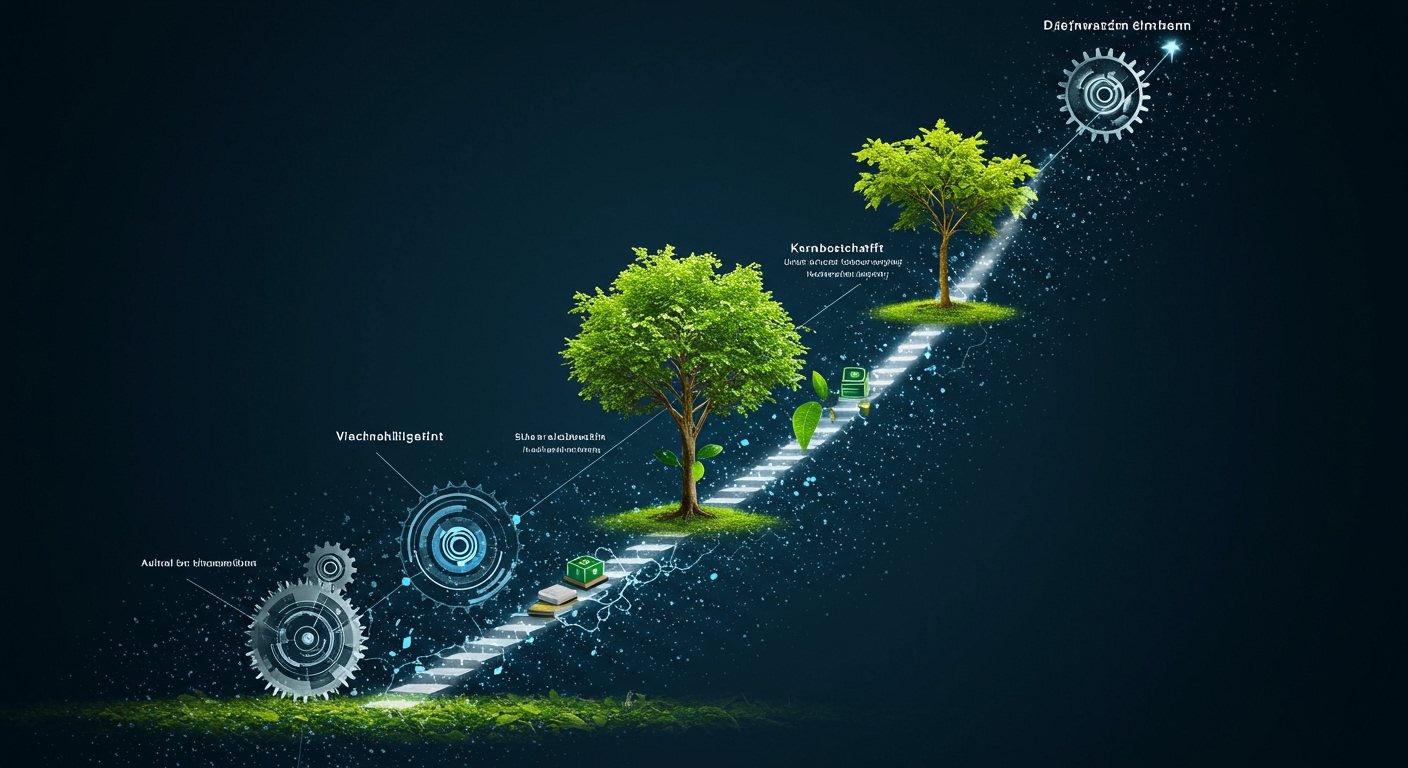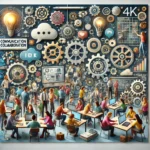Die rapide digitale Transformation und die drängende Notwendigkeit einer sozial, ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Entwicklung sind die prägenden Megatrends des 21. Jahrhunderts. Sie gestalten unsere Gesellschaft, Wirtschaft und unser individuelles Leben grundlegend um. In diesem Spannungsfeld entsteht das Konzept der Digitainability, eine Wortschöpfung, die die untrennbare Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit umschreibt. Für das Bildungssystem bedeutet dies nicht nur eine Anpassung an neue Technologien, sondern eine fundamentale Neuausrichtung, um Lernende auf eine Welt vorzubereiten, in der diese beiden Kräfte Hand in Hand gehen müssen, um eine zukunftsfähige und lebenswerte Realität zu schaffen.
Die Symbiose von Digitalität und Nachhaltigkeit (Digitainability)
Digitainability beschreibt das Potenzial digitaler Innovationen und Anwendungen, als entscheidende Instrumente im Kampf für mehr Umweltschutz und zur Bewältigung zentraler Herausforderungen einer notwendigen nachhaltigen Entwicklung zu dienen. Die Digitalisierung bietet große Chancen, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Sie kann datengetriebene Effizienzsteigerungen ermöglichen und digitale Innovationen für Bereiche wie nachhaltige Stadtentwicklung, Kreislaufwirtschaft und Energiewende vorantreiben. Auch für Bildung, Gesundheit und soziale Innovationen eröffnen sich umfassend neue Möglichkeiten. Digitale Technologien können, wenn sie achtsam eingesetzt werden, wichtige Informationen zeitnah verbreiten, die Transparenz erhöhen, das Bewusstsein schärfen und die Menschen über notwendige Entscheidungen und Maßnahmen für eine nachhaltige Zukunft aufklären.
Jedoch birgt diese Symbiose auch Risiken. Der hohe Energie- und Ressourcenverbrauch digitaler Technologien ist eine Herausforderung, die eine gezielte nachhaltigere Gestaltung digitaler Prozesse und Technologien erfordert. Die Frage, wie Digitalisierung im Einklang mit nachhaltiger Entwicklung gebracht werden kann, ist daher zentral. Dies erfordert einen reflektierten Umgang mit digitalen Medien und die Befähigung, technologischen Fortschritt kritisch zu bewerten und zu nutzen.
Die Zukunft der Bildung: Kompetenzen für eine komplexe Welt
Die Anforderungen an Bildung haben sich im Zuge der digitalen Transformation und der Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklung dramatisch gewandelt. Es geht nicht mehr primär um die reine Wissensvermittlung, sondern darum, Lernende mit den notwendigen Kompetenzen auszustatten, um die Zukunft aktiv mitzugestalten. Die Schule von morgen bereitet auf lebenslanges Lernen vor, da sich Berufsfelder und Anforderungen rasant verändern.
Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts
Im Zentrum zukunftsfähiger Bildung stehen die sogenannten 4K-Kompetenzen: Kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um in einer von Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUKA-Welt) geprägten Zeit agil und handlungsfähig zu bleiben.
Kritisches Denken im digitalen Zeitalter
Die Fähigkeit, digitale Medien kritisch zu nutzen, ist eine Kernkompetenz. Dies umfasst die Medienkritik, also die Reflexion über Medieninhalte und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, sowie das technische Verständnis und Wissen über Funktionsweisen von Medien. Es ist entscheidend zu verstehen, wie Medieninhalte entstehen, wie sie uns erreichen und wie sie uns beeinflussen können. Angesichts der Verbreitung von Desinformationen und unseriösen Nachrichten im Netz ist die Förderung einer kritischen Medienkompetenz und eines reflektierten Umgangs mit Informationen eine besonders wichtige Aufgabe der Erwachsenenbildung. Bildung muss Lernende dazu befähigen, digitale Medien zu analysieren, zu bewerten, zu verstehen und zu reflektieren. Der Einsatz digitaler Medien kann und soll Lernende zum Nachdenken über die Welt, zum kritischen Reflektieren und zum kommunikativen Austausch anregen.
Kompetenzentwicklung Digitalisierung und Nachhaltigkeit
Die berufliche Bildung und die Hochschulbildung stehen vor der Herausforderung, die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit inhaltlich miteinander zu verknüpfen. Ein neu entwickeltes Kompetenzmodell integriert beide Dimensionen gleichberechtigt und dient als Leitfaden für eine zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung. Dabei geht es darum, Kompetenzen für eine digitalisierte Welt zu erwerben und gleichzeitig Kompetenzen für die nachhaltige Gestaltung der Gesellschaft zu entwickeln. Eine multiperspektivische und verschränkte Betrachtung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung birgt große Potenziale für eine zukunftsorientierte Hochschulbildung.
Ganzheitliche Bildungskonzepte und zukunftsfähige Lernumgebungen
Um diesen komplexen Anforderungen gerecht zu werden, sind ganzheitliche Bildungskonzepte unerlässlich. Diese Konzepte müssen über die reine Ausstattung mit IT-Infrastruktur hinausgehen und grundlegende Veränderungen in den Lernzielen, der Pädagogik und den Lernumgebungen berücksichtigen. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist dabei ein Treiber für die gesamte Agenda 2030 der UN und soll sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben. BNE ist eine ganzheitliche und transformative Bildung, die Lerninhalte und ‑ergebnisse, Pädagogik und die Lernumgebung berücksichtigt, mit dem Ziel, eine Transformation der Gesellschaft zu bewirken.
Lernumgebungen der Zukunft
Digitale Medien sind ein fester Bestandteil des Lernens geworden und ermöglichen ein individualisiertes, chancengerechtes, selbstgesteuertes und kooperatives Lernen. Sie können als Werkzeuge des Lehrens und Lernens eingesetzt werden und gleichzeitig als Lerninhalt im Zentrum des unterrichtlichen Geschehens stehen. Interaktive und lernendenzentrierte sowie problemorientierte Lernsettings, die reflexive und transformative Innovations- und Lernräume schaffen, sind hierbei entscheidend. Beispiele wie Online-Themengemeinschaften, Gamification oder die Schaffung von Virtual- und Augmented-Reality-Lernumgebungen zeigen das enorme Potenzial, Lerninhalte produktiv und sozial erfahrbar zu machen, jenseits physischer Grenzen.
Gesellschaftliche Resilienz durch Bildung stärken
Gesellschaftliche Resilienz im digitalen Wandel beschreibt die Fähigkeit von Individuen, Organisationen und Gesellschaften, sich an fortlaufende Veränderungen durch technologische Innovationen anzupassen und diese proaktiv mitzugestalten. Bildung spielt eine Schlüsselrolle beim Aufbau dieser Resilienz.
Digitale Resilienz: Die Fähigkeit zur Anpassung
Digitale Resilienz ist die Fähigkeit, digitale Herausforderungen zu bewältigen und sich schnell von technischen Störungen, Cyberangriffen oder anderen digitalen Bedrohungen zu erholen. Für die Gesellschaft bedeutet dies, die Vorteile der Digitalisierung voll auszuschöpfen und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken zu minimieren. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Überbrückung der digitalen Kluft, um sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu digitalen Ressourcen und Kenntnissen haben und somit eine inklusive digitale Gesellschaft geschaffen wird. Bildungseinrichtungen müssen gewährleisten, dass Schülerinnen und Schüler die notwendigen digitalen Kompetenzen erwerben, um die digitale Transformation erfolgreich zu bewältigen.
Es ist unerlässlich, dass Menschen die notwendigen Fähigkeiten und die Motivation haben, den digitalen Wandel mitzugestalten, um zu verhindern, dass Teile der Gesellschaft sich durch Überforderung abwenden und abgehängt werden. Der Erwerb digitaler Kompetenzen – ein Leben lang – ist dafür eine Grundvoraussetzung.
Herausforderungen und Potenziale der Transformation
Die digitale Transformation des Bildungswesens bringt vielfältige Herausforderungen mit sich. Dazu gehören der Ausbau und die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Infrastruktur, die Entwicklung qualitätsgesicherter digitaler Lernangebote und die Sicherstellung des Datenschutzes sowie der Kinderrechte im Internet. Auch die Qualifizierung des Lehrpersonals mit geeigneten IT-Kompetenzen ist essenziell. Eine weitere Herausforderung ist die Gefahr, dass der Einsatz von Technologie bestehende Ungleichheiten im Zugang zu Bildung verstärken kann, wenn nicht alle Lernenden über die nötigen digitalen Ressourcen und Kompetenzen verfügen.
Dennoch überwiegen die Potenziale bei weitem. Digitale Technologien können Barrieren abbauen und Bildung inklusiver gestalten, indem sie beispielsweise Menschen in abgelegenen Gebieten oder mit besonderen Bedürfnissen erreichen. Sie ermöglichen zeit- und ortsunabhängigen Zugang zu umfangreichen Bildungsressourcen und können das pädagogische Personal bei der Organisation von Bildungsprozessen unterstützen. Multimediale, interaktive und adaptive digitale Werkzeuge können die Qualität individueller und kollaborativer Lehr-Lernprozesse erheblich steigern.
Fazit
Die Zukunft der Bildung ist untrennbar mit der konvergenten Entwicklung von Digitalität und Nachhaltigkeit verbunden – der Digitainability. Diese integrative Perspektive ist nicht nur ein Trend, sondern eine essenzielle Notwendigkeit, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern und die Chancen einer technologisch fortgeschrittenen, ökologisch bewussten und sozial gerechten Gesellschaft zu nutzen. Bildungssysteme müssen sich proaktiv wandeln, um Lernende mit den Kompetenzen für eine nachhaltige digitale Welt auszustatten, die über reine technische Fertigkeiten hinausgehen. Dies erfordert die Förderung von kritischem Denken, Kreativität, Kooperation und gesellschaftlicher Resilienz. Indem wir ganzheitliche Bildungskonzepte entwickeln, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit als sich gegenseitig verstärkende Kräfte begreifen, schaffen wir die Grundlage für eine lernende Gesellschaft, die den Wandel nicht nur bewältigt, sondern aktiv und verantwortungsvoll gestaltet.
Weiterführende Quellen
https://www.hfp.tum.de/policy/projekte-in-forschung-lehre/lehrprojekte/digitainability/
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/294758/digitale-bildung-und-nachhaltigkeit/