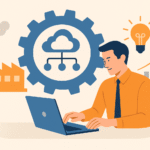Das geplante Bundestariftreuegesetz (BTTG) steht kurz vor der Einführung und soll die Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes grundlegend neu gestalten. Ziel ist es, die Tarifbindung in Deutschland zu stärken und faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, indem Lohndumping bei staatlich finanzierten Projekten unterbunden wird. Doch das Vorhaben, das die Einhaltung tarifvertraglicher Arbeitsbedingungen zur Bedingung für Bundesaufträge macht, birgt sowohl Chancen als auch erhebliche Herausforderungen, insbesondere für den Mittelstand und kleinere Unternehmen.
Die Kernidee des Bundestariftreuegesetzes (BTTG)
Die Bundesregierung verfolgt mit dem Bundestariftreuegesetz das zentrale Ziel, die seit Jahren sinkende Tarifbindung in Deutschland umzukehren. Aktuell arbeiten nur noch rund 41 bis 49 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben. Mit dem BTTG soll der Staat seine Marktmacht als größter Auftraggeber nutzen, um Unternehmen dazu zu bewegen, ihren Angestellten mindestens die im entsprechenden Tarifvertrag festgelegten Arbeitsbedingungen zu gewähren. Dies betrifft nicht nur Löhne, sondern auch andere Konditionen wie Arbeitszeit, Urlaub und Sonderzahlungen. Damit soll Lohndumping mit Steuergeld ein Riegel vorgeschoben und tarifgebundene Unternehmen im Wettbewerb geschützt werden, die bisher möglicherweise durch Unternehmen mit niedrigeren Löhnen unterboten wurden.
Das Gesetz sieht vor, dass öffentliche Aufträge des Bundes künftig nur noch an Unternehmen vergeben werden, die sich zur Einhaltung tarifvertraglicher Arbeitsbedingungen verpflichten – das sogenannte „Tariftreueversprechen“. Für Bauaufträge liegt die Schwelle bei 50.000 Euro, für Liefer- und Dienstleistungsaufträge bei 30.000 Euro. Bei Start-ups in den ersten vier Jahren nach Gründung gilt für allgemeine Verträge eine höhere Schwelle von 100.000 Euro.
Umsetzung und Compliance-Anforderungen
Die Umsetzung des Bundestariftreuegesetzes bringt umfassende Pflichten für Auftragnehmer mit sich. Kernstück ist das Tariftreueversprechen, das Unternehmen abgeben müssen, um sich für öffentliche Aufträge zu qualifizieren. Dieses Versprechen umfasst nicht nur die direkten Arbeitnehmer des Auftragnehmers, sondern erstreckt sich auch auf deren Nachunternehmer und beauftragte Verleiher. Die Auftragnehmer sind verpflichtet, die Einhaltung der tariflichen Bedingungen bei ihren Nachunternehmern sicherzustellen und zu überprüfen, um Vertragsstrafen oder den Ausschluss von der öffentlichen Auftragsvergabe zu vermeiden.
Nachweispflichten und Kontrollen
Unternehmen, die einen öffentlichen Auftrag erhalten, müssen die Einhaltung der tariflichen Bedingungen nachweisen können. Welche Unterlagen genau dafür vorzulegen sind, ist noch nicht vollständig konkretisiert, es sollen jedoch geeignete Dokumente wie Lohnabrechnungen verlangt werden können. Die Vergabestellen der Bundesauftraggeber werden die Einhaltung stichprobenartig kontrollieren. Eine Kontrolle muss in jedem Fall stattfinden, wenn Hinweise Dritter einen Verstoß nahelegen.
Um den bürokratischen Aufwand zu begrenzen, ist ein Präqualifizierungsverfahren vorgesehen. Zertifizierte Unternehmen können sich dadurch von wiederholten Einzelnachweisen befreien lassen und ihre Tariftreue quasi im Voraus bescheinigen. Dennoch stellt die umfassende Nachweis- und Dokumentationspflicht eine erhebliche Anforderung an die Compliance im Vergaberecht dar. Verstöße gegen das Tariftreueversprechen, Nachweis- und Dokumentationspflichten oder die Einhaltung der Arbeitsbedingungen können gravierende Folgen haben, darunter Vertragsstrafen von bis zu zehn Prozent des Auftragswertes, Kündigung des Auftrags und der Ausschluss von zukünftigen Vergabeverfahren. Ein robustes Compliance-System wird somit zu einer zentralen Voraussetzung, um überhaupt öffentliche Aufträge erhalten zu können und im Falle von Verfehlungen eine „Selbstreinigung“ des Unternehmens zu ermöglichen.
Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Gerade für den Mittelstand und KMU, die häufig nicht tarifgebunden sind, birgt das Bundestariftreuegesetz potenzielle Wettbewerbsnachteile. Obwohl die Auftragswertschwelle auf 50.000 Euro (bzw. 30.000/50.000 Euro für bestimmte Auftragsarten) angehoben wurde, kritisieren Wirtschaftsverbände, dass Ausnahmen oder Erleichterungen für KMU oder Start-ups im Gesetz fehlen. Viele Familienunternehmen und mittelständische Betriebe warnen, dass sie aufgrund des erhöhten bürokratischen Mehraufwands und der komplexen Compliance-Anforderungen vom Wettbewerb um öffentliche Aufträge zurückgedrängt werden könnten.
Bürokratie statt Bürokratieabbau
Die Kritik am BTTG entzündet sich maßgeblich an der Befürchtung, dass es entgegen dem politischen Ziel des Bürokratieabbaus zu einem erheblichen Anstieg der administrativen Last für Unternehmen führen wird. Die Notwendigkeit, Tarifbedingungen nachzuweisen und deren Einhaltung zu kontrollieren, wird sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Vergabestellen zu einem Mehraufwand führen. Dies könnte besonders für kleinere Betriebe, die keine eigenen Rechts- oder Compliance-Abteilungen unterhalten, eine Überforderung darstellen und sie davon abhalten, sich überhaupt an öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen. Der Wirtschaftsrat kritisiert, dass es widersinnig sei, einerseits ein großes Infrastruktur-Sondervermögen aufzulegen und andererseits die Vergaberichtlinien so zu verkomplizieren, dass das Geld nicht effizient ausgegeben werden kann.
Einschränkung des Wettbewerbs
Während das BTTG fairen Wettbewerb durch die Verhinderung von Lohndumping fördern soll, sehen Kritiker auch eine Einschränkung des Wettbewerbs selbst. Unternehmen, die sich bewusst gegen konventionelle Tarifverträge entschieden haben – möglicherweise aufgrund flexiblerer Arbeitsmodelle oder übertariflicher Bezahlung außerhalb fester Tarifstrukturen –, könnten benachteiligt werden. Dies könnte zu Verwerfungen im Markt führen und die Auswahl an Bietern für öffentliche Aufträge, insbesondere in Branchen mit geringer Tarifbindung wie der Digitalwirtschaft, einschränken. Die Konsequenz könnte eine Verlangsamung von dringend benötigten Infrastrukturprojekten sein, da weniger Unternehmen bereit oder in der Lage sind, die Voraussetzungen zu erfüllen.
Tarifbindung fördern: Ein Blick in die Zukunft
Das Bundestariftreuegesetz reiht sich ein in eine Reihe von politischen Maßnahmen, die die Tarifbindung in Deutschland stärken sollen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass das Gesetz einen erheblichen Anreiz für mehr Unternehmen schaffen wird, Tarifverträge anzuwenden und damit die Arbeitsbedingungen für viele Beschäftigte zu verbessern. Dies hätte nicht nur positive Auswirkungen auf die Einkommen und die Kaufkraft, sondern auch auf die Sozialversicherungssysteme und Steuereinnahmen.
Befürworter sehen im BTTG einen wichtigen Schritt, um der sinkenden Tarifbindung entgegenzuwirken und die Sozialpartnerschaft als Fundament der sozialen Marktwirtschaft zu festigen. Es ist ein klares Signal, dass der Staat „Gute Arbeit“ fördert und nicht akzeptiert, dass immer weniger Beschäftigte vom Schutz von Tarifverträgen profitieren.
Fazit
Das Bundestariftreuegesetz (BTTG) 2025 markiert einen entscheidenden Paradigmenwechsel in der öffentlichen Auftragsvergabe in Deutschland. Mit dem klaren Ziel, die Tarifbindung zu stärken und faire Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, verpflichtet es Unternehmen, die sich um Bundesaufträge bewerben, zur Einhaltung tarifvertraglicher Standards. Während Befürworter dies als wichtigen Schritt gegen Lohndumping und zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte sehen, äußert der Mittelstand erhebliche Bedenken. Die befürchteten Bürokratiezuwächse, Nachweispflichten und die potenziellen Wettbewerbsnachteile für nicht-tarifgebundene KMU könnten den Zugang zu öffentlichen Aufträgen erschweren und Investitionen in wichtige Infrastrukturprojekte verlangsamen. Die Umsetzung des BTTG wird zeigen müssen, ob es gelingt, die positiven Ziele der Tarifbindung zu erreichen, ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit und die administrative Belastbarkeit der deutschen Unternehmenslandschaft zu überfordern.